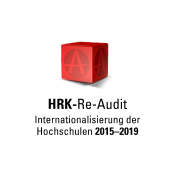Für mehr Nachhaltigkeit in Sport und Kultur

Wie können Kultur- und Sportveranstaltungen nachhaltiger geplant und durchgeführt werden? Welche Strategien helfen Vereinen und Kultureinrichtungen, sich nachhaltig aufzustellen? Mit dem neuen Herausgeberband „Nachhaltigkeitsmanagement in Sport und Kultur. Grundlagen – Anwendungen – Praxisbeispiele“ widmen sich Prof. Dr. Gerd Nufer von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen und Mitherausgeber Prof. Dr. André Bühler von der HfWU Nürtingen-Geislingen den unterschiedlichen Facetten eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagements mit exklusiven Brancheneinblicken.
Professor Dr. Gerd Nufers Veröffentlichungen über Sportmanagement und Sportmarketing zählen zu den sportökonomischen Standardwerken im deutschsprachigen Raum. Im neuen Lehrbuch kommen insgesamt 27 Expertinnen und Experten zu Wort und behandeln umfassend die immer größere gesellschafts- und wirtschaftspolitische Rolle der Nachhaltigkeit im Sport-, Event- und Kulturbereich. „Wir haben uns zunächst mit den grundlegenden Themen des Nachhaltigkeitsmanagements beschäftigt und gehen auf die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Funktionen eines nachhaltigen Managements ein. Darauf aufbauend beleuchten wir spezielle Aspekte des Nachhaltigkeitsmanagements in Sport und Kultur und stellen Fallbeispiele aus dem Fußball, Basketball, Golfsport sowie aus dem Kultursektor vor“, beschreibt Nufer das Werk. Für den Praxisteil hat er – erstmals gemeinsam mit seiner Tochter Gabriela Nufer – die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar als Fallstudie erforscht.
In der aktuellen Sport- und Kulturlandschaft sei aktuell in Bezug auf nachhaltiges Handeln noch Spielraum. „Veranstaltungen im Sport- und Kulturbereich sind per se nicht umweltfreundlich. Akteure wie Sportlerinnen und Sportler oder Schauspielerinnen und Schauspieler müssen ebenso wie das Publikum an den Ort der sportlichen Wettkämpfe und kulturellen Aufführungen gebracht werden. Sport- und Eventstätten müssen beheizt und unterhalten werden. Wettkampfutensilien und Requisiten werden für Sport- und Kulturevents um die ganze Welt geflogen. All das trägt nicht gerade zu einer CO2-Reduktion bei“, erklärt Prof. Nufer den Status Quo.
Positive Entwicklungen gibt es aber bereits zu verzeichnen. So hat beispielsweise die Deutsche Fußball Liga (DFL) für die erste und zweite Bundesliga ein umfassendes Nachhaltigkeits-Regelwerk geschaffen, das Bestandteil der Lizenzierungsordnung ist. Mitgliedervereine dürfen zukünftig nur dann an den Wettbewerben der DFL teilnehmen, wenn sie konkrete Nachhaltigkeitsstrategien verfolgen und entsprechende Maßnahmen implementieren. Dazu gehören jährliche Messungen des Wasserverbrauchs, der Abwasserproduktion und des Energieverbrauchs sowie eine Mobilitäts- und Verkehrsanalyse. Darüber hinaus müssen die Clubs einen Verhaltenskodex für ihre Mitarbeitenden nachweisen und sich klar zu einer vielfältigen Gesellschaft bekennen.
Beispielhaft für den Nachhaltigkeitsprozess in Kultureinrichtungen betrachten Prof. Nufer und seine Kolleginnen und Kollegen in einem Kapitel des Buches die Entwicklung der Szene in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden: „Innerhalb von nur zwei Jahren wurden für bedeutsame Kulturbetriebe der Stadt Dresden Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt und implementiert. Auf der Grundlage der Dresdner Charta für Nachhaltigkeit haben sich zahlreiche weitere Dresdner Kulturinstitutionen zur nachhaltigen betrieblichen Transformation verpflichtet. „Culture for Future“ steht damit beispielhaft für einen strategischen Ansatz im öffentlich finanzierten Kultursektor“, fanden die Forscherinnen und Forscher heraus.
Vielen Menschen und Unternehmen sei längst bewusst, dass es ein „Weiter so“ nicht geben dürfe. Zudem sei es wirtschaftlich klug, auf Nachhaltigkeit zu setzen: „Unternehmen können langfristig ihre Zukunft nur sichern, wenn sie ihre Geschäftstätigkeit an Nachhaltigkeit orientieren und diese fundamental in ihrer strategischen Ausrichtung und in den Köpfen sämtlicher Anspruchsgruppen verankern“, schlussfolgert Nufer. Dennoch sei festzustellen, dass immer noch ein relevanter Anteil der Gesellschaft nicht bereit ist, höhere Kosten und Einschränkungen des eigenen Lebensstandards zu Gunsten von nachhaltigen Verhaltensweisen hinzunehmen. Dies sei beim Besuch von großen Sport- und Kulturveranstaltungen nicht anders, als beispielsweise bei der Mobilität im alltäglichen Straßenverkehr. Daher bedürfe es zusätzlich mehr gesetzlicher und verbandsrechtlicher Regularien, um Nachhaltigkeit in Sport- und Kulturbetrieben zu verankern.